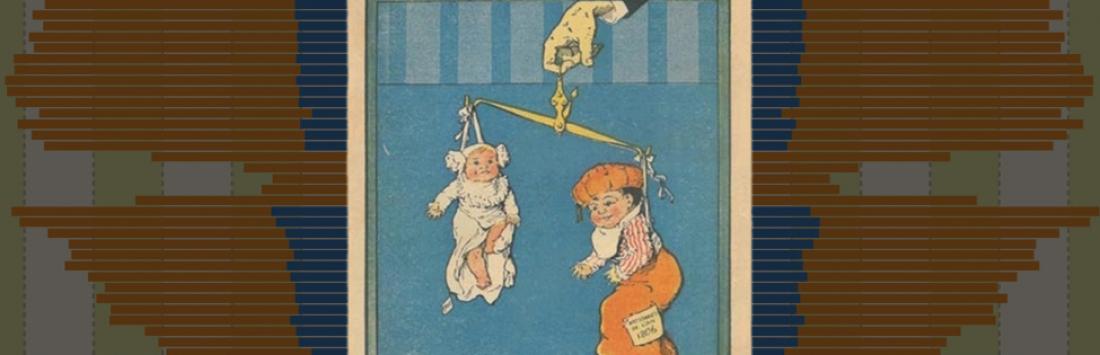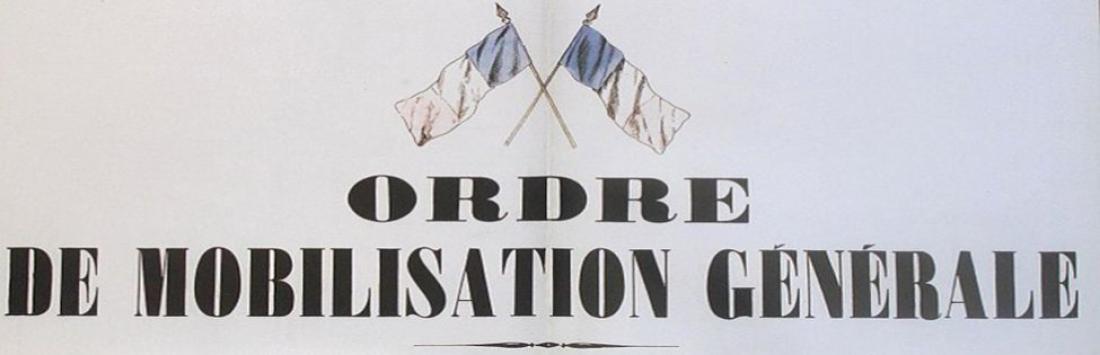Friedhof an der Route de Solesmes
Der an der Route de Solesmes gelegene Friedhof erinnert nicht nur an das Schicksal dieser Stadt, die vom 26. August 1914 bis zum 9. Oktober 1918 von den Deutschen besetzt war, sondern vor allem an die erste Schlacht von Cambrai vom 20. November bis zum 3. Dezember 1917, an die deutsche Offensive vom März 1918, die zweite Schlacht von Cambrai und letzte Schlacht an der Hindenburg - Linie, durch die die Stadt schließlich im Oktober 1918 befreit wurde, nachdem sie furchtbar zerstört worden war.
Später wurde die Stadt von dem County Borough Birkenhead "adoptiert". Dieser Friedhof war von den Deutschen während der Besetzung eingerichtet worden, seit März 1917. Sie hatten einige Grabdenkmäler und ein Steinkreuz gesetzt, und am 11. August 1918 hatte der bayrische Kommandant der Festung die Stadt mit der Pflege des Friedhofs beauftragt. Später wurde der deutsche Soldatenfriedhof, der sich in Cambrai auf dem Friedhof Saint-Sépulcre befand, hierher überführt. Die Gräber wurden inzwischen neu angeordnet. Auf dem Friedhof liegen 10 685 gefallene Deutsche, 192 Russen, 6 Rumänen und 502 Briten.
An der Straße Cambrai - Bapaume, 13 km nordöstlich von Bapaume, befindet sich das Denkmal von Louverval. Es erinnert an die 7 048 britischen und südafrikanischen Soldaten, die in der Schlacht von Cambrai im November und Dezember 1917 gefallen sind und die an unbekannten Orten begraben sind. Die Schlacht von Cambrai mit einem Durchbruch am 20. November, einem Halt in den Stellungen am 22. und einem deutschen Gegenangriff vom 23. bis 29. November, ergab zwar nur wenig Gewinn an Terrain, brachte aber für die Alliierten wertvolle taktische und strategische Erkenntnisse. Die Deutschen ihrerseits hatten entdeckt, dass ihre Verteidigungslinie verwundbar war. Das Denkmal, das sich auf einer Terrasse an einem Ende des Soldatenfriedhofs befindet, wurde von H. Chalton Bradshaw entworfen. Der Bildhauer war C.S. Jagger, der die beiden Basreliefs mit den Schlachtszenen geschaffen hat.
Das Jahr 1917 war für alle kriegführenden Parteien ein schreckliches Jahr während des Ersten Weltkriegs. Ende des Jahres wollten die Briten die Hindenburg - Linie durchbrechen (Verteidigungssystem in den von den Deutschen besetzten Gebieten) und beschlossen, südlich von Cambrai eine Offensive mit massivem Panzereinsatz zu starten. Die Schlacht ist grausam: in den ersten Kämpfen sind die britischen Truppen siegreich, außer in Flesquières, aber sehr schnell beginnen die zunächst ratlosen Deutschen mit einem kräftigen Gegenangriff. 15 Tage lang folgen Angriffe und Gegenangriffe aufeinander, ohne dass eine der beiden Armeen einen entscheidenden Sieg davonträgt. Die Verluste an Menschen sind enorm: 45 000 Briten und 55 000 Deutsche fallen, und ganze Dörfer werden zerstört. Während des Ersten Weltkriegs taucht eine neue Waffe auf den Schlachtfeldern auf: die Panzer. Sie sollten die Angriffe der Infanterie unterstützen und ihnen helfen, durch die feindlichen Linien zu gelangen. In der Schlacht vom November 1917 sollte das "Panzerkorps" der dritten britischen Armee (insgesamt 476 Panzer) die Hindenburg - Linie durchbrechen.
Ziel der Schlacht war die Einnahme der strategischen Stellungen auf den Anhöhen von Flesquières und dem Wald von Bourlon, bevor man zur Befreiung von Cambrai ansetzte. In Flesquières traf der britische Angriff auf erbitterten Widerstand der deutschen Truppen, die viele Panzer zerstörten oder kampfunfähig machten. Einer der zerstörten Panzer wurde im Frühjahr 1918 von den Deutschen vergraben. Im November 1998 wurde er dank einiger Passionierter wieder entdeckt. Heute können sie dieses Erinnerungsstück an den Krieg in Flesquières sehen. In Cambrai ist diese Schlacht vor allem durch das Denkmal für die Soldaten der Regimenter von Cambrai gegenüber dem Eingang zur Zitadelle verewigt, und durch das Denkmal des Souvenir Français, das die Namen aller Einwohner von Cambrai trägt, die bei den Schlachten des Ersten Weltkriegs gefallen sind. Der Friedhof von Louverval ist hierfür eine wichtige Stätte der Erinnerung.
Merkmale: - 26,5 Tonnen - 8,50 Meter lang - 3,20 Meter breit - 52 cm breite Ketten - 5 Maschinengewehre mit 13 000 bis 30 000 Patronen - Besatzung von 8 Mann.
Auf der Anhöhe von Flesquières spielt sich die sicherlich wichtigste Episode der Schlacht von Cambrai ab. Mit dem Blick ins Tal können wir uns den Beginn des britischen Angriffs am 20. November 1917 vorstellen, an einer Front von etwa 8 km Länge, von Havrincourt bis Bonavis. An dieser Stelle befand sich eine Mühle. Da sie als Orientierungspunkt für die britische Artillerie dienen konnte, wurde sie von den Deutschen zerstört. Heute sind eine Orientierungstafel mit dem Verteidigungssystem der Hindenburg - Linie und ein Denkmal zu Ehren der gefallenen Soldaten der Schlacht an dieser Stelle geplant.
Die charakteristische Form dieses oberirdischen Bunkers der Deutschen entspricht seiner Benutzung, er diente zur Beobachtung. Auf Grund seiner Lage war es möglich, durch optische Signale mit Cambrai zu kommunizieren. Der Beobachtungsposten lag neben der Mauer des Schlossparks. Heute ist alles noch in einem sehr gutem Zustand.
Die genaue Rekonstruktion eines Schützengrabens der damaligen Zeit wurde hergestellt, als der Dokumentarfilm "The Trench" von der BBC hier gedreht wurde. Die Besichtigung des Schützengrabens und des Panzers ist auf Anmeldung möglich.
Flesquières Hill British Cemetery
Auf diesem Friedhof, wie auf allen Friedhöfen mit über 400 Gräbern, hat die Commonwealth War Graves Commission einen "Stein der Erinnerung" errichtet, mit der Aufschrift "Their Name Liveth For Evermore". Ihr Name bleibt auf ewig lebendig. Der Friedhof beherbergt 589 bekannte und 332 unbekannte Gräber. Zusammen mit den Briten sind neuseeländische Soldaten und Australier hier begraben, die an den Schlachten des Kriegsendes teilgenommen haben.
Orival Wood British Cemetery
Hier ist der berühmte englische Dichter, Leutnant Ewart Alan Mackintosh, begraben. An derselben Stelle befinden sich Gräber von kanadischen und deutschen Soldaten, die im Abschnitt von Flesquières gefallen sind.