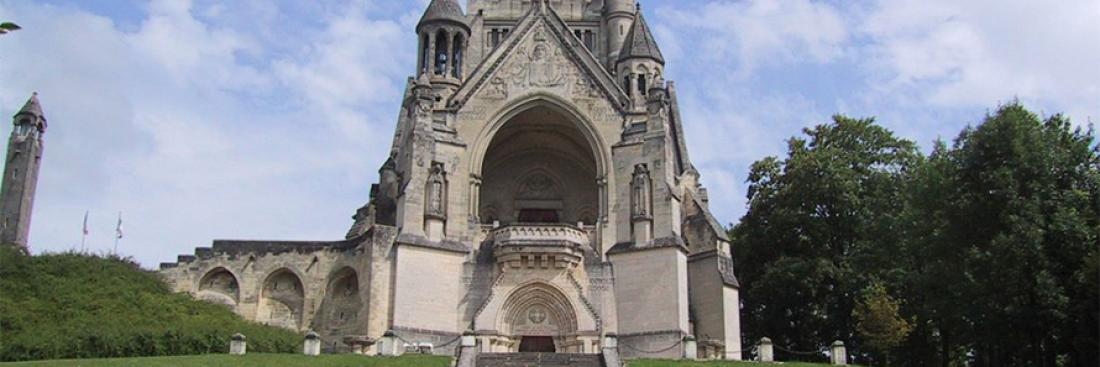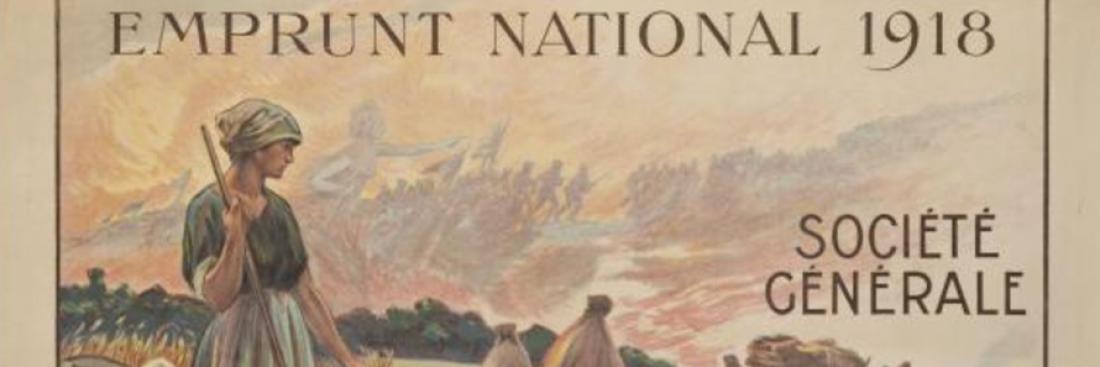1940. Ralliements de l'Empire à la France Libre

À la suite de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, les volontaires désireux de rallier l'Angleterre et la France Libre commencent à affluer, mais l'attaque de la flotte française par les Britanniques à Mers el-Kébir, action menée de crainte que les navires ne tombent aux mains des Allemands, porte un coup sérieux au recrutement. La France Libre ne représente début juillet qu'une poignée d'hommes exilés, tributaires du soutien britannique.